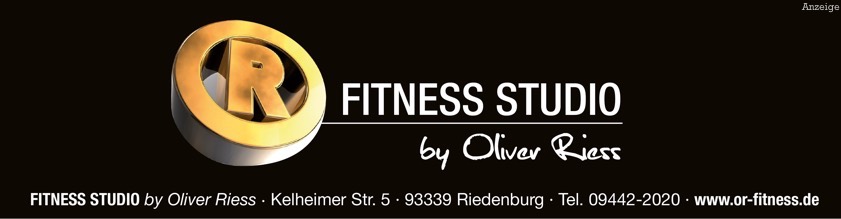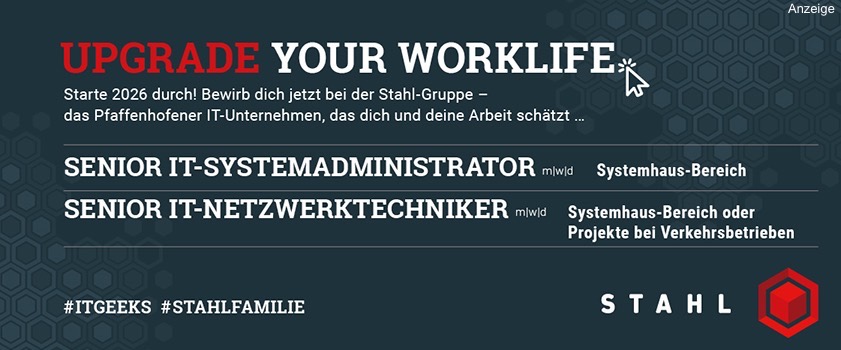Johannes Stampfl (34) will als Vorsitzender des neuen "Bewässerungs-Verbands Hallertau" die Zukunft des weltweit größten Hopfen-Anbau-Gebiets sichern. Das Thema hat er auch wissenschaftlich bearbeitet.
(ty) "Wir machen das nicht, um unsere Erträge zu steigern." Diese Klarstellung ist Johannes Stampfl wichtig. Angesichts der klima-bedingt wachsenden Trockenheit müsse man rechtzeitig handeln und Vorsorge treffen, "sonst würde unserer Hopfen-Anbau-Gebiet langfristig nicht mehr existieren", betont der Vorsitzende des Bewässerungs-Verbands für die Hallertau. 460 Hopfen-Pflanzer aus sechs Landkreisen hatten sich im Herbst vergangenen Jahres unter der Führung des 34-Jährigen zusammengeschlossen, um "eine nachhaltige, umweltverträgliche und verlässliche Versorgung der Hallertauer Hopfen mit ausreichend Wasser im Sommer ermöglichen", wie es in den Statuten des Verbands formuliert ist (Ausführlicher Bericht). Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Stampfl, im Hauptberuf Vorstands-Mitglied bei der Hopfen-Verwertungs-Genossenschaft (HVG), was ihn dazu bewegt, sich für diese Aufgabe zu engagieren.
Der promovierte Agrar-Wissenschaftler entstammt einer Hopfenbauern-Familie in Au in der Hallertau (Kreis Freising). Den Betrieb führt sein Bruder, aber Johannes Stampfl kennt die Arbeit in den Hopfengärten von Kindesbeinen an und hilft dort in seiner Freizeit weiterhin gerne mit, wie er erzählt. Bei der Hopfen-Verwertungs-Genossenschaft mit Sitz in Wolnzach ist der 34-Jährige seit dem Jahr 2021 beschäftigt. Im Juli vergangenen Jahres rückte er in den Vorstand auf, wo er sich seither um den Einkauf und die Sorten-Züchtung kümmert. Dass man ihm an die Spitze des Bewässerungs-Verbands für die Hallertau gewählt hat, kommt nicht von Ungefähr, denn mit dem Thema ist er seit etlichen Jahren vertraut wie kaum ein anderer.
Was es heißt, unter schwierigen klimatischen Bedingungen erfolgreich Hopfen anzubauen, hat Stampfl in den USA hautnah miterlebt. Das Yakima-Valley im US-Bundesstaat Washington, wo er 2013 ein Auslands-Jahr in einem Hopfen-Betrieb verbracht hat, gilt trotz der dort herrschenden Trockenheit als eine der weltweit führenden Regionen für die Produktion des Bier-Rohstoffs. "Ohne Bewässerung geht es dort gar nicht", sagt Stampfl. Die Thematik hat ihn auch danach nicht mehr losgelassen, sodass er sich auch in seiner Doktor-Arbeit intensiv wissenschaftlich damit auseinandersetzte. Angesichts des fortschreitenden Klima-Wandels müsse man sich damit zwangsläufig auch in der hiesigen Region beschäftigen, ist der 34-Jährige überzeugt. "Der Klima-Wandel ist Fakt. Und wird müssen etwas dagegen tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben."


"Seit den 2010er-Jahren nimmt die Zahl der Trocken-Jahre merklich zu", verweist Stampfl auf die untrüglichen Daten der Wetter-Statistik. Am schlimmsten seien die Jahre 2022 und 2023 gewesen, in denen man in der Hallertau deutliche Ernte-Einbußen von bis zu 30 Prozent habe hinnehmen müssen. Effektiv auf die zunehmende Trockenheit reagieren können seinen Worten zufolge nur recht wenige Betriebe. "Etwa 20 Prozent der Hopfen-Flächen können im Augenblick bewässert werden", berichtet Stampfl. Um Missernten aufgrund von Trockenheit in bezahlbarer Weise vorzubeugen, bleibe kein anderer Weg als sich gemeinschaftlich zu wappnen, wie es nun der "Bewässerungs-Verband Hallertau" vorhat.
Machbarkeits-Studien zeigten, dass man mit der ausschließlichen Verwendung von Oberflächen-Wasser, etwa aus Donau, Isar und Amper, sowie Ufer-Filtrat eine "nachhaltige, umweltverträgliche und verlässliche Versorgung" hinbekomme, betont der Verbands-Vorsitzende. Das Grundwasser werde mit dieser Lösung nicht angetastet. Deswegen könne man bei dem Vorhaben auch auf die Unterstützung der Wasserwirtschafts-Behörden sowie des Umwelt-Ministeriums und des Landwirtschafts-Ministeriums im Freistaat bauen, so der 34-Jährige. Was die notwendigen Wasser-Mengen angeht, gebe es bislang nur Schätzungen. "Wir brauchen in einem Trocken-Jahr pro Hektar etwa 1000 Kubikmeter Wasser", sagt Stampfl. Davon sollen rund 400 Kubikmeter aus Speichern zur Verfügung stehen.
Wie das Ganze funktionieren könnte, untersuche man derzeit auf einer Pilot-Fläche bei Niederulrain im Gemeinde-Gebiet von Neustadt an der Donau. "Da sind wir schon einen Schritt weiter", sagt Stampfl. Die anfallenden Kosten für eine künftige Bewässerung könne man derzeit ebenfalls nur schätzen, sagt der Verbands-Chef. Aber mit 25 000 bis 30 000 Euro pro Hektar werde man wohl rechnen müssen. In einem nächsten Schritt wolle man die Planung für das Gesamt-Vorhaben in Auftrag geben. Bis diese vorliegt, werden nach Stampfls Einschätzung noch etwa zwei Jahre ins Land gehen. Auch bei der späteren Umsetzung plane man in Jahren. Die komplette Hallertau auf einmal mit Rohrleitungen und Speichern zu versehen, sei sicher nicht machbar.
Zum Hintergrund:
Wegen Klimawandels: Hopfen-Bewässerung in der gesamten Hallertau geplant